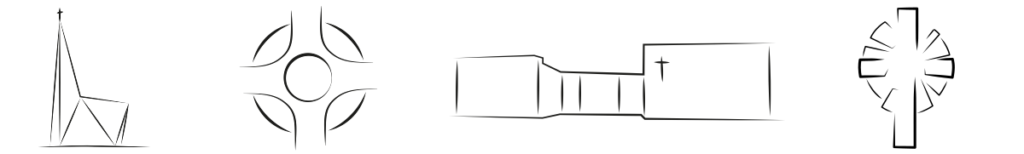Als „Abend der Erinnerung…“ aber auch als Blick in die Zukunft“, so Pfarrer Dietmar Hermann, war die Einstimmung am Auftaktsonnabend vor dem 50-jährigen Jubiläum von St. Andreas am 1.6.2019, gedacht. Um 19h waren bereits fast 100 Interessierte vor der Kirche zusammengekommen – knapp ein Drittel davon waren keine bekannten Gemeindegesichter, um bei einer kleinen Stadtteilführung über den gleich nebenan liegenden Dresdner Platz, die über 50-jährige gemeinsame Vergangenheit, angeleitet durch den Stadtführer Sven Föll – der selbst in Orschel-Hagen aufwuchs – und ergänzt durch alle anwesenden Zeitzeug*innen, Revue passieren zu lassen.
 Föll geizte, wie manche Anwesenden – in seinem Rückblick – auch nicht mit O-Tönen aus der damaligen Zeit. St. Andreas besondere Form wurde, war zu hören, – in der bewegten Zeit der 60er Jahre, mit dem ersten amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, römisch-katholischer Konfession, mit Konrad Adenauer, dem katholischen ersten deutschen Bundeskanzler und dem ersten katholischen Kanzler, Kurt Georg Kiesinger, der mit einer großen Koalition regierte – im Jahr der 1. Mondlandung zuweilen auch als „Seelenabschussrampe“ betitelt. Von 1960 bis 1970 fuhr an Orschel-Hagen auch die Linie 4 der Straßenbahn entlang.
Föll geizte, wie manche Anwesenden – in seinem Rückblick – auch nicht mit O-Tönen aus der damaligen Zeit. St. Andreas besondere Form wurde, war zu hören, – in der bewegten Zeit der 60er Jahre, mit dem ersten amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, römisch-katholischer Konfession, mit Konrad Adenauer, dem katholischen ersten deutschen Bundeskanzler und dem ersten katholischen Kanzler, Kurt Georg Kiesinger, der mit einer großen Koalition regierte – im Jahr der 1. Mondlandung zuweilen auch als „Seelenabschussrampe“ betitelt. Von 1960 bis 1970 fuhr an Orschel-Hagen auch die Linie 4 der Straßenbahn entlang.

Das Nachkriegsprinzip – zur Durchmischung – in rein evangelischen Gebieten gezielt Katholik*innen anzusiedeln, war auch in Reutlingen, der Reformationsstadt der 1. Stunde, angesagt. An manchen vergleichbaren Orten der Region, wie Trochtelfingen, hat dies – bis heute – tatsächlich zu einer 50-prozentigen Verhältnismäßigkeit der Konfessionen geführt. Dieser Plan, für einen gesellschaftlichen Ausgleich, ging also auf.

In den Schaufenstern der Geschäfte sind – derzeit – großformatige historische Fotos aus den ersten Jahren des (Einkaufs-)Zentrums Orschel-Hagens ausgehängt. – Diese wurden vorab gemeinsam mit den Kirchengemeinderatsmitgliedern Thomas Draxler und Ingrid Wiedmann, sowie dem Fan historischer Bilder, Raimund Vollmer, im Stadtarchiv ausgewählt und an die ursprünglichen Orte der Geschäfte verteilt.
Es lief, erstellt durch Raimund Vollmer, auch eine Multimediaschau als Endlosschleife im Kircheninneren, was den wechselnden Zeitfenstern der Gäste, zwischen Schmaus und Plausch, schon am Vorabend, vor der Stadtführung oder während und nach dem anschließendem Picknick sehr entgegenkam. Aber auch noch am Sonntag standen immer wieder Interessierte vor den eindrücklichen Bildern – unterlegt mit stimmig-monumentale Musik – der Präsentation im Kircheninneren. – Vom symbolischen ersten Spatenstich 1966, über die Grundsteinweihe und das Richtfest 1967, die folgende Kreuzsetzung auf der Turmspitze und den ersten Gottesdienst, am Gründonnerstag, im darunterliegenden Gemeindesaal 1968, bis zur endgültigen Einweihung1969 waren die Fotos chronologisch hintereinandergeschaltet. Auch ein paar Rundumblicke – vom über 50 Meter hohen Kirchturm – auf das damals ebenfalls noch in Fertigstellung befindliche Orschel-Hagen.

Fast wie ein Feriendorf… wirkt auf Anhieb der Kern der Reutlinger „Gartenstadt“, des Stadtteils Orschel-Hagen. Wie von Sven Föll am Samstagabend erklärt wurde, war das Konzept der Gartenstadt ursprünglich ein von dem Briten Ebenezer Howard, im Jahr 1898 in England, entworfenes Modell der planmäßigen Stadtentwicklung, als Reaktion auf die schlechten Wohn- und Lebensverhältnisse sowie zeitgleich steigende Grundstückspreise in den stark gewachsenen Großstädten.
Etwas außerhalb „im Grünen“ der Großstadt Reutlingen – wurde auch hier – wegen der (auch!) zur damaligen Zeiten größer gewordenen Wohnungsnot, bezahlbarer Wohnraum, für die vielen kleineren und mittleren Wohnraumwünsche, auf dem Reißbrett geplant und quasi aus dem Boden gestampft. Man wollte, nach dem Konzept, viel Grün, eine konsequente Trennung von Fußwegen und Fahrstraße – An Fahrradwege hatte damals noch Keiner gedacht!, schmunzelte Föll -, großzügige Gartenanlagen, Sandkästen, Golfplatz, Spielplatz. Viel wurde in den 80er, 90er und 2000er Jahren noch dazu gebaut.
Bei der Findung der Straßennamen hatte man viel nachgedacht, diese sollten – nach langen Diskussionen im Gemeinderat der Kommune – im ersten Bauabschnitt, aus alter Tradition, nach alten freien Reichsstädten in Deutschland benannt werden. Eine Idee des derzeitigen Oberbürgermeisters Oskar Kalbfell, die fast konsequent verwirklicht werden sollte. So schafften es immerhin 21 deutsche freie Reichsstädte namentlich genannt zu werden, von der Aalener Straße bis zur Wormser Straße. Neben der Crailsheimer und der Heidenheimer Straße fallen der Berliner Ring und der Dresdner Platz etwas aus diesem Raster. Geschuldet ist dies den einschlägigen welthistorischen Ereignissen der 60er Jahre. Der Berliner Ring wurde im 2. und 3. Bauabschnitt 1962 begonnen, zur Zeit des Mauerbaus. Zu diesem symbolischen Akt liegt heute noch im Stadtarchiv der Stadt ein Dankesschreiben des damaligen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Willy Brandt. Was den Bruch mit der konsequenten Namensgebung beim zentralen „Dresdner“ Platz auf sich hat, der just am Ende des letzten Bauabschnitts entstand. Hier war man explizit gewillt „das Beste zum Schluss“ kommen zu lassen, wollte es moderner, wollte „…bitte keine alten Namen mehr!“, so Föll. Nach einem weiteren monatelangen Hin und Her, wobei Straßburger Platz auch favorisiert mit im Spiel war, einigte man sich schließlich auf den heute noch gültigen Namen Dresdner Platz.

In der Großform eines „Schmetterlings“ wurden die geschwungen anmutenden Straßenführungen, um ein Einkaufszentrum – als die eine Hälfte eines Herzstücks – inklusive Polizeistation, Fahrschule, Postfiliale, Sparkasse, Bank, Ärzte – ein Friseur durfte auch nicht fehlen – und sogar eine Zweigstelle der Stadtbibliothek, für eine wirtschaftlich expandierende Zukunft, für eine „Zeit der Aufbruchsstimmung“, linear-mäandernd arrangiert. Manche der heutigen Geschäfte und Nutzbauten kamen allerdings erst später dazu, zum Beispiel die Bebauung durch das Sparkassenareal, dort wo früher ein Spielplatz war.

Der Mittelpunkt der kleinen Satellitenstadt am Dresdner Platz, „Er erfüllt auch heute noch, seine ursprünglich angedachten Zwecke“, so eine Teilnehmerin der spannenden Führung am Samstagabend. Dieser damals hochmoderne Häuserbau war sehr gewünscht! – „Jawohl, wir wollen das so modern wie möglich machen!“, hieß es damals, „eine moderne Stadt der kurzen Wege“.
Und tatsächlich, relativ unverändert, sieht das Gesamtensemble aus Hoch- und Reihenhäusern, sowie ein Komplex von öffentlichen Gebäuden, im Bauhausjahr 2019, noch immer recht brauchbar und zweckdienlich aus. – Es gab schräg hinter dem Ortszentrum noch eine Schule und den Kindergarten und sogar ein kleiner See, für Gerberbetriebe, wurde dort angelegt.
Sven Föll wusste angesichts der Palette an Möglichkeiten als Kind bereits genau, er wolle einmal „bei der Poschd arbaida, die hätten nicht zu viel zu tun…“. Nach einem heiteren Gelächter kamen dann bei manchen Besuchern gleich weitere Erinnerungen aus der eigenen Kinderzeit hoch.

Den alten Konsum gibt es nicht mehr. Der Gastwirt der heute noch existierenden Gaststätte „Ring“ hieß unter den Kindern der „Schorle“. Beim „Milcher“ gab es damals die Milch noch in Kannen, und es gab nicht nur Käse, es gab auch „Schleck“ für ein oder zwei Pfennige, beim „Bauder“ war er teurer, und deshalb war dieser der „wichtigste“ Laden. Einmal hätte ein Freund einen 10 DM-Schein geschenkt bekommen, sie hätten den sofort „verklopft in Süßis“, danach „wär ihne so schlecht gwesn“ wie niemals mehr im Leben, gibt Föll zu.
Beim Konfektions- und Wäschegeschäft kaufte der Vater die Anzüge und, wenn sie Glück hatte, hat die Mutter für sich auch was „zum Anziehn“ gefunden.
Der freundliche Beamte auf der Bank habe den Überfall heil überstanden und sich außerdem immer Zeit genommen um ein Formular anzunehmen. Wo jetzt die öffentlich zugänglichen Bücher in einem Glasschrank stehen war früher die Telefonzelle. Bei der Stadtbücherei schließlich, da habe sich als Einziges in den letzten 5 Jahrzehnten scheinbar gar nichts verändert. „Die gleichen Öffnungszeiten wie damals!“, stellt eine Zuhörerin fest. Wie damals, nur nachmittags und jeweils nur drei Stunden, an vier Tagen der Woche.
Dem ins Stadtarchiv ausgeschwärmten Team Draxler, Wiedmann und Vollmer wurde am Ende ganz herzlich gedankt, für die so schön ausgewählten – überschaubar und spannenden – Bilder für die Schaufenster. Der Stadtführer erläuterte noch den Umstand, dass es damals sehr viel mehr Bildmaterial leider nicht gegeben habe. In den 60er und 70 er Jahren habe die Bevölkerung noch relativ wenig Geld zum Ausgeben für Luxusgüter besessen, am Wenigsten habe man damals deshalb Geld gehabt für einen guten Fotoapparat.- Eine ortskundige Zeitzeugin wusste auf dem kurzen gemeinsamen Rückweg zur Wiese vor der Kirche, wo das – gelb-weiß – gehaltene Festzelt zum Picknick, aber auch die Jurte der Pfadis zum Pubquiz schon warteten, noch etwas zum damals großen Kinderreichtum zu berichten. Bei 8-10000 Einwohnern reichten die Kindergärten bei weitem nicht aus, sie platzten aus allen Nähten. Die Wartezeiten und Wartelisten zur Aufnahme waren lang. Und so bekam so manches Orschel-Hagener Kind dieser Zeit frühestens ab 4 Jahren einen Kindergartenplatz und höchstens für 1-2 Jahre.
Die zweite Herzhälfte…
bilden ungefragt die beiden – direkt an die „Shoppingmall der 70er“ – angrenzenden Kirchen, die evangelische Kirche „Jubilate“ (geplant 1962 und erbaut 1967) mit dem über 30 Meter hohen Glockenturm und die katholische Kirche St. Andreas, mit dem 50 Meter hohen, metallisch-segelförmigen Spitzturm die ebenfalls schon 1962 geplant war, aber erst am 14. Juni 1969, fast auf den Tag genau vor 50 Jahren, durch Weihbischof Carl Josef Leibrecht eingeweiht werden konnte. – Beide Kirchen prägen deutlich die Silhouette Reutlingens vor dem Albtrauf.

Vorab mussten die Orschel-Hagener katholischen Gläubigen sich noch in einer Baracke, ganz in der Nähe, auf Höhe des heutigen Alten- und Pflegeheims Gertrud Luckner, für die sonntägliche Messe einfinden. Dort begründeten sie auch ihre ersten Ehrenamtskreise, wie die heute noch existierende Gruppe „Frauen knüpfen Kontakte“. „Die Katholik*innen mussten in diesem neuen Stadtteil Reutlingens lange auf ihre Kirche warten“, so die Worte des damaligen 1. Bürgermeisters Karl Guhl.
Laut Guhl war mit dem Stadtteilprojekt – in der damals aufstrebenden Industriestadt Reutlingen – die Schaffung ordentlicher Wohnverhältnisse angestrebt worden um nicht nur den Bedarf der kinderreicher gewordenen Familien, sondern auch den sich erhöhenden Zuzug der vielen Vertriebenen, die (Ober-)Schlesier und die Banater Schwaben, die oft unter erbärmlichsten Umständen kamen und ihr Leben hier neu aufbauen wollten, aufzufangen. Schließlich kamen ab 1978, dann noch die sogenannten „boatpeople“ – die die heutige vietnamesische Gemeinde formen – die vorab erst im angrenzenden Rappertshofen, untergebracht worden war, bevor sie in die „Gartenstadt“ übersiedelten.
In den 60er Jahren war Orschel-Hagen als bewusst autarker Stadtteil, der weniger einer Trabanten-, sondern mehr einer Satellitenstadt ähneln sollte, erdacht. Denn „Hier wird ein Stadtteil gebaut, dessen Zusammenleben eine gewisses Eigenleben haben wird, das zu einer gewissen Selbstständigkeit beiträgt!“, so die Worte des damaligen 1. Bürgermeisters Karl Guhl. Er wurden dafür, von der Kommune – um jeglichen Bodenspekulationen vorzubeugen – 80 HA Land, zu einem sehr guten Preis zur Verfügung gestellt, und von 1960 bis 1970, in sieben Bauabschnitten, 2400 Wohnungen als Heimstatt für 8-10000 Menschen errichtet.
Der Name soll sich von den beiden im Norden Reutlingens gelegenen Fluren ableiten, auf denen der Stadtteil errichtet wurde. Der erste Bestandteil des Namens Norsel könnte sich auf die geographische Lage im Norden der Reutlinger Gemarkung beziehen. Der Namensbestandteil sel komme von Althochdeutsch selida (= Haus, Hütte). Der Name Orschel könne daher auf einen kleineren Bauernhof im Norden Reutlingens Bezug genommen haben. Der Name Hagen, schwäbischen beziehungsweise mittelhochdeutschen Ursprungs, könne als eine mit Dornbüschen umgrenzte Weide beschrieben werden.
Hier fanden die verschiedenen Neuzugezogenen, von denen viele aus katholischen Gegenden herkamen, rund um die Andreaskirche ihre neue Heimat, denn der gemeinsame Glaube verband sie, auch über unterschiedliche Kulturgrenzen hinweg. Aber, so Guhl: „Es war ein langer und mühsamer Weg bis Orschel-Hagen endlich seine eigene katholische Kirche bekam.“ – 1962 gewann der Architekt Wilfried Max Beck-Erlang (1924-2002) – in Erlangen geboren und in Reutlingen aufgewachsen – den Wettbewerb mit seiner, in der Formgebung die Symbolik der heiligsten Dreifaltigkeit betonenden, Planungs-idee für einen Kirchenbau. (Beck-Erlang hatte sich als Erstes in seiner Heimatstadt, bereits 1952-53, durch den Bau des, am Bahnhof gelegenen und heute nicht mehr existierenden, Parkhotels „Friedrich-List“ einen Namen gemacht. In den 70ern baute er, neben weiteren Kirchen und Wohnhäusern, unter anderem das Planetarium in Stuttgart und in Mannheim). 1967 wurde endlich der Grundstein geweiht und erst 1969 konnte die Kirche eingeweiht werden. – Ein metallisches Zeltdach, gestützt durch leiterartig glasbesetzte Stahlträger, die regelmäßige Lichteinfälle gewährleisten und dabei das schräg liegende Andreaskreuz abbilden, gab dem Bau gleich auch den Namen des 1. Apostels Jesu mit auf den Weg.
Wer einmal in der Nähe von Krakau durch eine, in den 50er Jahren ähnlich geschaffene, komplette Vorortstadt, namens „Nowa Huta….“ (zu deutsch etwa `Neue Hütte´) – geführt wurde, der erkennt erstaunlich bemerkenswerte Parallelen. Sie war dort in den 50ern als sozialistische Mustersiedlung – ebenfalls – aus dem Boden gestampft worden, mit Wohnraum für allerdings 100 000 Menschen. Nowa Huta war ebenfalls als eigene (Vor-)-Stadt geplant und besitzt deshalb – auch heute noch – alle Versorgungseinrichtungen. Dort aber verlangte die Bevölkerung jahrelang vehement nach einem Gebäude, das damals vom sozialistischen Regime im Plan der vermeintlichen Idealstadt nicht vorgesehen war: einer Kirche. In den 70er Jahren schließlich wurde diese dort, durch – von überwiegend tief gläubigen katholischen Bewohnern – eigener Hände Arbeit und mit dem – von ihnen – selbst herbei geschaffenem Baumaterial erbaut.

Beim Picknick im Zelt wurden am Auftaktsonnabend des 1. Juni 2019, munter Salate, Wurst, selbstgebackene Hörnchen und Brote ausgepackt, herumgereicht und im munteren Gespräch gemeinsam genossen. Wer kein Essen zum Anbieten mit hatte spendierte dafür – das Grundnahrungsmittel schlechthin – ein paar Bier oder andere Getränke.
Ausblick:
Am Tag des Deutschen Denkmals, am 8. September, um 15h, gibt Stadtarchivar, Sven Föll, eine ausführlichere Führung zu Fuß, durch ganz Orschel-Hagen
Der Film „ Leben in Orschel-Hagen“, den Raimund Vollmer derzeit mit Zeitzeugen dreht, wird am 10. November gezeigt.



















Mechthild Betz